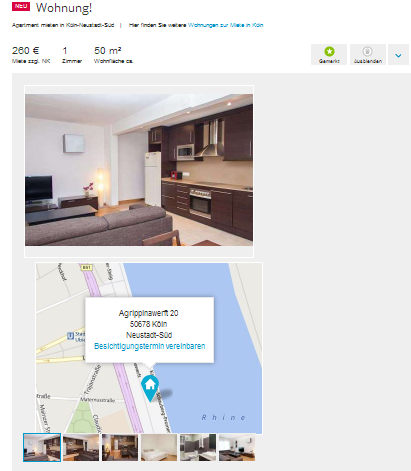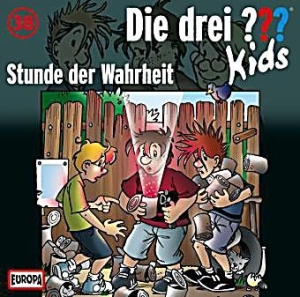“A. & V. ANGERER’S ANSICHTEN VON WIEN.
M. Frankenstein & Cie. Phot. – Nachdruck verboten.”
“Der Kaisergarten.”
Burggarten (Kaisergarten, Hofgarten)
Josefsplatz 1, 1010 Wien
https://de.wikipedia.org/wiki/Burggarten_%28Wien%29
Der Burggarten
ist eine öffentliche Parkanlage an der Wiener Ringstraße.
Das Palmenhaus im Burggarten, Wien.
Martin Furtschegger, 2011.
Geschichte
Auf dem Gelände befand sich ursprünglich
die Vorstadt vor dem Widmertor,
seit dem 16. Jahrhundert war es Teil des Glacis vor der Wiener Stadtmauer.
Ab 1637 lag dort die Augustinerschanze.
Nachdem 1809 Augustinerschanze und Augustinerbastei von den Franzosen gesprengt wurden, wurde nur die Bastei wiederaufgebaut.
1817–1821 wurde die Hornwerkskurtine weiter nach außen verlegt. Auf dem so neu entstandenen Gelände hinter der Augustinerbastei wurde dann der
Kaisergarten,
ursprünglich Hofgarten
angelegt. Er war der Privatgarten des Kaisers.
Die Abtrennung vom Heldenplatz erfolgte durch eine Mauer und eine Auffahrtsrampe. Die Anlage wurde wie der Volksgarten von Ludwig Gabriel von Remy und Hofgärtner Franz Antoine dem Älteren geplant, allerdings unter der persönlichen Mitwirkung von Kaiser Franz, der ja selbst ausgebildeter Gärtner war. Man legte besonders auf neuartige Pflanzen Wert, weshalb in- und ausländische Gärtner kontaktiert wurden. Auch hier gab es später eine Umgestaltung von Franz Antoine dem Jüngeren, allerdings in Form eines englischen Landschaftsgartens.
1863 wurde die Hornwerkskurtine abgebrochen und der Park gegen die Ringstraße erweitert, wobei auch der heutige Teich angelegt wurde.
1863–1865 wurde auch die Einfriedung von Moritz Löhr angelegt.
Wegen des Baus der Neuen Hofburg wurde der Garten ab 1881 auf der Nordseite verkleinert. Die Mauer wurde dabei beseitigt.
1919 wurde die Anlage öffentlich zugänglich und kurzzeitig in Garten der Republik und endgültig in Burggarten umbenannt. Unter der Terrasse vor der Neuen Burg wurden 1988–1992 Tiefspeicher für die Österreichische Nationalbibliothek angelegt.
Heute wird er von den Bundesgärten, einer Dienststelle des Lebensministeriums, betreut.
Gebäude
Palmenhaus: Ludwig von Remy ließ hier ursprünglich zwei Glashäuser errichten, diese wurden ab 1900 durch das heutige secessionistische Palmenhaus von Friedrich Ohmann ersetzt.[1]
Es liegt parallel zur Augustinerbastei und hat eine erhöhte Terrasse.
Heute befindet sich im linken Flügel das Schmetterlinghaus mit tropischen Pflanzen und Schmetterlingen, der mittlere Teil wird von einem Café-Restaurant genutzt.
#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien, 1873 – Neues #Musikvereinsgebäude, #Musikvereinsplatz 1
“A. & V. ANGERER’S ANSICHTEN VON WIEN.
M. Frankenstein & Cie. Phot. – Nachdruck verboten.
DAS MUSIKVEREINSGEBÄUDE.”
Musikvereinsplatz 1
Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Musikverein
Der Wiener Musikverein
(beziehungsweise das Haus des Wiener Musikvereins)
ist ein traditionsreiches Konzerthaus in Wien. In diesem Haus befindet sich der berühmte Große (Goldene) Musikvereinssaal, der als einer der schönsten und akustisch besten Säle der Welt gilt. Der Musikverein befindet sich im 1. Wiener Gemeindebezirk, Innere Stadt, am Musikvereinsplatz.
Innere Stadt, 1010 Vienna, Austria.
h_laca, 2014.
Geschichte
1812 wurde die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien von Joseph Sonnleithner gegründet. Ab November 1831 veranstaltete sie Konzerte in einem Saal an den Tuchlauben Nr. 12, der sich mit nur 700 Sitzplätzen bald als zu klein erwies.
1863 stimmte Kaiser Franz Joseph dem Vorschlag des beim Innenministerium für die neue Wiener Ringstraßenzone zuständigen Stadterweiterungsfonds zu, der Gesellschaft das dem Staat gehörende Areal am Wienfluss neben dem Bauplatz des Künstlerhauses, gegenüber der Karlskirche, unentgeltlich für ein Konzertgebäude zu überlassen.
Mit der Planung wurde der klassizistische Architekt Theophil von Hansen beauftragt. Es sollten zwei Säle werden, ein großer für Orchester- und ein kleiner für Kammermusikkonzerte. Sämtliche Steinmetzarbeiten führte die Wiener Firma Anton Wasserburger aus; nach ihren Eigenschaften, aber auch ihrer Verfügbarkeit, wurden Sandsteine aus Breitenbrunn und St. Margarethen, harte Kalksteine von Kaisersteinbruch am Leithagebirge und Wöllersdorf verwendet.
Das Haus wurde am 6. Jänner 1870 mit einem feierlichen Konzert eröffnet, und die Kritik lobte sogleich einhellig die grandiose Akustik des Großen Saales, dessen Ruhm sich in kurzer Zeit in der ganzen Welt verbreitete. Auch der kleine Saal, der 1937 nach Johannes Brahms benannt wurde, erhielt bald den Ruf, ein idealer Ort für Kammermusik zu sein.
Im Jahr 2004 wurden vier kleinere, unterirdische Säle eröffnet, die für Konzerte ebenso wie für Proben, Konferenzen, Workshops oder Empfänge konzipiert sind und für größtmögliche Flexibilität in der Nutzung mit modernster Technik ausgestattet wurden. Ursprünglich hätte diese Erweiterung vom amerikanischen Musikmäzen Alberto Vilar finanziert werden sollen. Nachdem dieser abgesprungen war, half der austro-kanadische Industrielle Frank Stronach aus.
Architektur
Der Musikverein ist im historisierenden Stil nach Vorbildern aus der griechischen Antike gebaut: Säulen, Karyatiden und Giebel-Reliefs lassen die Assoziation zu, hier sei ein Tempel für die Musik errichtet worden.
Der große Saal ist mit einem Deckengemälde von August Eisenmenger und Plastiken von Franz Melnitzky versehen, der kleine wurde erst 1993 wieder in seiner ursprünglichen Form mit roten Säulen und grünen Marmorwänden wiederhergestellt. In der Regel stehen 1744 Sitzplätze und 300 Stehplätze zur Verfügung.
Die vier neuen Säle im Keller des Hauses wurden vom Architekten Wilhelm Holzbauer geplant und nach dem jeweils dominanten Grundbaustoff Glas, Metall, Stein und Holz benannt.
https://www.wien.gv.at/wiki/index.php?title=Neues_Musikvereinsgeb%C3%A4ude
Musikvereinsgebäude, neues
(Haus der Gesellschaft der Musikfreunde;
1, Dumbastraße. 3, Karlsplatz 6, Canovagasse 4, Bösendorferstraße 12).
1., Dumbastrasse 3, Musikverein, um 1900.
Bildquelle: HMW 106630/2, Foto: A. Stauda Bildrechte: Wien Museum.
Das 1867-1870 durch Theophil Hansen als Konzerthaus, Konservatorium und Vereinshaus mit zwei großen Konzertsälen erbaute Haus Schlusssteinlegung am 5. Jänner 1870; erstes Konzert am 6. Jänner, erster Ball am 15. Jänner, erstes Konzert im Kleinen Saal [Brahmssaal] am 19. Jänner [Clara Schumann]; wenige Stunden danach brach am 20. Jänner in der Garderobe ein Brand aus [Hansen beteiligte sich persönlich an den Löscharbeiten]).
Äußeres
Gebäude im Stil „hellenistischer Renaissance“, jedoch in freier Mischung antiker Bauelemente. Die Hauptfront mit ihrem Mittelrisalit wendet sich dem Künstlerhaus zu; der Mittelbau (mit dem großen Saal) überragt die Seitenflügel, die rundum Balustraden aus Terrakotta tragen (Statuen von Franz Melnitzky [von dem auch die drei Figuren in der Loggia stammen], Genien von Raimund Novak). Die beiden Giebel des Mittelbaus blieben leer, weil die in der Tonwarenfabrik Drasche hergestellten Figurengruppen vor der Auslieferung durch einen Fabriksbrand zerstört und nicht wieder erzeugt wurden. In den ebenerdigen Nischen an der Hauptfront der Seitenflügel wurden 1875/1876 zehn Figuren berühmter Musiker (von Vincenz Pilz, geschaffen 1865) aufgestellt. Das Musikvereinsgebäude wurde 1911 (durch den Hansen-Schüler Ludwig Richter; unter anderem Abnahme der zehn Musikerfiguren [vier von ihnen wurden ins Foyer transferiert, das Gluckdenkmal steht heute in der Nähe der Karlskirche], Neugestaltung der zu den Vorräumen des großen Saals führenden Prunktreppen, Zurücksetzung der Karyatiden in diesem Saal zur Schaffung besserer Sichtverhältnisse von den Logen zum Podium) und 1937/1938 (durch Pfann und Weise) umgebaut.
1., Dumbastrasse 3, Musikverein, um 1940.
Inneres
Zwei geradlinige Prunktreppen führen vom Foyer (vier Statuen von Pilz und vier Musikerbüsten) zum „Goldenen Saal“ mit seiner äußerst prunkvollen Dekoration: das Deckengemälde „Apollo und die neun Musen“ schuf August Eisenmenger, die Galerie wird längsseitig scheinbar von je 16 vergoldeten Hermen-Karyatiden (nach Modellen von Melnitzky) getragen. In den Seitenflügeln befinden sich der Brahmssaal (Kleiner Saal, 1937 nach Johannes Brahms benannt.; Brahmsbüste von Arthur Trebst, 1897) und der Kammersaal. 1973 mussten die Brandschutzvorrichtungen, die Heizung sowie die Parketten und die Bestuhlung erneuert werden, 1986/1887 wurden der „Goldene Saal“ (Neuvergoldung der Decke), der Brahmssaal, die Pausenräume und das Foyer renoviert.
Erweiterung
Am 20. März 2004 wurden die nach Plänen von Wilhelm Holzbauer gestalteten unterirdisch in Richtung Künstlerhaus bis zu 16 Meter unter dem Straßenniveau liegenden vier Veranstaltungssäle für das Publikum geöffnet. Die Kosten beliefen sich auf rund 30 Millionen Euro. Entsprechend den vorherrschend verwendeten und damit den jeweiligen Raum prägenden Baumaterialien erfolgten die Bezeichnungen Gläserner, Metallener, Steinerner und Hölzerner Saal. Das absolute Schmuckstück, der von Frank Stronach finanzierte Gläserne Saal, der dem Goldenen Saal nachempfunden ist und auch die Bezeichnung Magna-Auditorium trägt, soll vorwiegend für Konzerte zur Verfügung stehen, kann aber auch als Kinosaal Verwendung finden (Besucherkapazität 380 Personen). Der Metallene Saal (70 Plätze) ist als eine Art Black-Box gestylt. Der Steinerne und der Hölzerne Saal eignen sich besonders für Ausstellungen, Symposien, Empfänge und Bankette. Bei Veranstaltungen im Magna-Auditorium kann der Hölzerne Saal als Pausenfoyer eingesetzt werden. Hubpodien machen es möglich, die Räume rasch für den benötigten Verwendungszweck umzuwandeln (als Konzertsaal, Tagungszentrum, Kino- oder Ballsaal). Alle vier Räume eignen sich auch als Probenräume für die Philharmoniker. Der Musikverein will mit der räumlichen Erweiterung nach eigener Aussage vor allem neues, jüngeres Publikum ansprechen.
Bedeutung
Das Musikvereinsgebäude war der Ort vieler interessanter Aufführungen, großer Elitebälle, Soireen und Maskenbälle sowie beliebter Künstlerabende und feenhafter Kostümfeste. Bis heute ist der „Musikverein“ ein Zentrum des Konzertlebens von internationalem Rang (Neujahrskonzert). Die Musikfreunde besitzen umfangreiche Sammlungen zur Geschichte der Musik (Noten, Musikinstrumente, Münzen, Medaillen, Autographen, Erinnerungsgegenstände und so weiter), ein reichhaltiges Notenarchiv sowie eine wertvolle Bibliothek.
Literatur
Felix Czeike: Wien. Innere Stadt. Kunst- und Kulturführer. Wien: Jugend und Volk, Ed. Wien, Dachs-Verlag 1993, S. 48
Franz Endler: Der Wiener Musikverein. 1987
Franz Grasberger, Lothar Knessl: 100 Jahre Goldener Saal. Das Haus der Gesellschaft der Musikfreunde am Karlsplatz. o. J. [1971]
Gustav Gugitz: Bibliographie zur Geschichte und Stadtkunde von Wien. Hg. vom Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien. Band 3: Allgemeine und besondere Topographie von Wien. Wien: Jugend & Volk 1956, S. 398
Katalog. Franz Joseph 2. 1984, S. 468 f.
Wilhelm Kisch: Die alten Straßen und Plätze von Wiens Vorstädten und ihre historisch interessanten Häuser. (Photomechan. Wiedergabe [d. Ausg. v. 1883]). Cosenza: Brenner 1967, Band 1, S. 621 f.
Paul Kortz: Wien am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein Führer in technischer und künstlerischer Richtung. Hg. vom Oesterreichischen Ingenieur und Architekten-Verein. Wien: Gerlach & Wiedling 1906. Band 2, 1906, S. 343 ff.
Renate Wagner-Rieger [Hg.]: Die Ringstraße. Bild einer Epoche. Die Erweiterung der Inneren Stadt Wien unter Kaiser Franz Joseph. 11 Bände. Wiesbaden: Steiner 1969-1981. Band 1, S. 130 f.
Renate Wagner-Rieger [Hg.]: Die Ringstraße. Bild einer Epoche. Die Erweiterung der Inneren Stadt Wien unter Kaiser Franz Joseph. 11 Bände. Wiesbaden: Steiner 1969-1981. Band 4, S. 304 ff.
Renate Wagner-Rieger: Wiens Architektur im 19. Jahrhundert. Wien: Österreichischer Bundesverlag 1970, S. 174 f.
Emil Winkler: Technischer Führer durch Wien. Wien: Lehmann & Wentzel 1873, S. 252 f.
Zu Erweiterung:
Tagespresse (beispielsweise Kurier, 29.10.2003, S. 29)
#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien, 1873 – #Votivkirche, #Maximilianplatz, #Freiheitsplatz, #Dollfussplatz, #Hermann-#Göring-Platz, #Rooseveltplatz
“A. & V. ANGERER’S ANSICHTEN VON WIEN.
M. Frankenstein & Cie. Phot. – Nachdruck verboten.
WIEN (Votivkirche).”
Votivkirche
Rooseveltplatz, 1090 Wien
https://de.wikipedia.org/wiki/Votivkirche_%28Wien%29
Die Wiener Votivkirche,
eine römisch-katholische Kirche nächst der Ringstraße im Gemeindebezirk Alsergrund in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hauptgebäude der Universität Wien gelegen, ist eines der bedeutendsten neugotischen Sakralbauwerke der Welt.
Deutsch: Schottentorpassage und Schleife Schottentor, sog. Jonasreindl
Esperanto: Duetaĝa trama returniĝa buklo „Jonasreindl“ (stacio Schottentor) en Vieno, en la fono la preĝejo Votivkirche.
Tokfo, 2013.
Die Entstehung des Ringstraßendoms, errichtet durch den Architekten Heinrich Ferstel, geht auf das Attentat auf den jungen Kaiser Franz Joseph I. am 18. Februar 1853 durch den Schneidergesellen János Libényi zurück. Mit einer Höhe von 99 Metern ist die Votivkirche die zweithöchste Kirche Wiens.
Français : Vue de Vienne au début du XXe siècle.
10. Januar 1905 dated by postmark and by the sender of the postcard.
Geschichte
Vorgeschichte
Franz Josephs Bruder, Erzherzog Ferdinand Maximilian, der spätere Kaiser von Mexiko, rief nach dem Attentat „zum Dank für die Errettung Seiner Majestät“ zu Spenden auf, um in Wien eine neue Kirche zu bauen. Die Kirche sollte als Votivgabe (Dankgeschenk) der Völker der Monarchie für die Errettung Franz Josephs errichtet werden. 300.000 Bürger folgten dem Spendenaufruf. Im neuen Dom sollten alle Nationen der Donaumonarchie ihre geistige und politische Heimat finden.
Der Kirchenbau wurde in einem Architektenwettbewerb im April 1854 ausgeschrieben, 75 Projekte von Architekten aus der Donaumonarchie, Deutschland, England und Frankreich wurden eingereicht. Die Jury entschied sich für das Projekt des damals erst 26-jährigen Architekten Heinrich Ferstel. Ursprünglich war für die Kirche ein Bauplatz in der Nähe des Schlosses Belvedere geplant gewesen. Diese Idee wurde jedoch auf Grund der Entlegenheit aufgegeben. Schließlich wurde als Baugrund ein Grundstück im Gebiet des abgerissenen Glacis in der Alservorstadt ausgewählt. Die Grundsteinlegung erfolgte am 24. April 1856 durch Kaiser Franz Joseph und Kardinal Rauscher in Anwesenheit von 80 Erzbischöfen und Bischöfen.
Svenska: Votivkirche i Wien.
Inköpta av Johanna Kempe, f. Wallis, i Wien vid hennes vistelse i nämnda stad tillsammans med fröken Caroline Pflaum under deras resa genom Österrike och norra Italien 21 Augusti – 25 November 1889.
Hallwyl Museum.
Baugeschichte
Der Bau der Kirche nahm schließlich über 20 Jahre in Anspruch. Zunächst wurden die Fundamente des Chors gelegt und der Chor errichtet, der 1857 bis in die Höhe der Absidialkapellen reichte und gemeinsam mit dem Kreuzschiff bis 1859 auf die Höhe der Seitenschiffe erhöht wurde. 1860 wurden die Fundamente der Türme geschaffen und der Langbau bis in die Höhe der Seitenschiffe gebracht. 1861 erreichte schließlich bereits die gesamte Kirche die Höhe der Seitenschiffe. 1862 bis 1863 erfolgte die Erhöhung der Türme und des Langhauses bis zur Höhe des Hauptschiffes, 1864 wurde mit dem Kreuzschiff begonnen und die Türme bis zum mittleren Dachgiebel erhöht. Besondere Energie steckte Ferstel in den Bau der Türme, da oftmals bei großen Kirchen die Türme unvollendet blieben. Durch eine Subvention von 150.000 Gulden des Wiener Gemeinderates konnte er schließlich die Türme im zehnten Baujahr vollenden und erreichte am 18. August 1868 eine Höhe von 99 m. 1872 wurde das Kirchenschiff schließlich eingewölbt und ein Jahr später wurden die eisernen Dachstühle aufgesetzt. Innenausstattung und die Vollendung der Bauarbeiten dauerten weitere sechs Jahre an. Nach 23 Jahren Bauzeit konnte die Kirche schließlich am 24. April 1879, anlässlich der Silberhochzeit des Kaiserpaares, geweiht werden.
Maximilian Place, Vienna, Austro-Hungary.
zwischen 1890 und 1900
Forms part of: Views of the Austro-Hungarian Empire in the Photochrom print collection.; Title from the Detroit Publishing Co., Catalogue J-foreign section, Detroit, Mich. : Detroit Publishing Company, 1905.; Print no. „16666“.
Der Platz vor der Votivkirche war der Maximilianplatz.
Zwischen 1862 und 1918 war die Votivkirche auf Anordnung von Kaiser Franz Joseph I. die katholische Garnisonskirche Wiens.
Die Wiener Votivkirche ist ein wesentliches Vorbild der Speyrer Gedächtniskirche.
Baubeschreibung
Deutsch: Votivkirche in Wien, Architekt: Ferstel
Wilhelm Lübke, Carl von Lützow (Hrsg.): Denkmäler der Kunst zur Übersicht ihres Entwicklungsganges von den ersten Versuchen bis zu den Standpunkten der Gegenwart. Zweiter Band. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage, Ebner & Seubert, Stuttgart 1879, S. 137: Architektur Taf. LVIII. Wiener Bauwerke
Grundriss
Die Votivkirche ist eine dreischiffige Basilika mit einem Chorumgang und einem Kapellenkranz; der Chor befindet sich im Westen. Das Hauptschiff ist neun Joch lang, das Querschiff hat eine Länge von sieben Joch. Der Punkt an dem sich Lang- und Querhaus schneiden, bildet die Vierung. Anstelle des Vierungsturmes befindet sich hier ein einfacher Dachreiter. Die östliche Hauptfassade wird von zwei kolossalen Türmen bestimmt. Außer der Vierung welche durch ein Sterngewölbe hervorgehoben wird, zeichnet sich die Votivkirche durch ein Kreuzgewölbe aus. Das Giebeldach des Langhauses und des Querhauses wird gekrönt von einer Firstzier. Die Seitenschiffe haben die halbe Breite und fast die halbe Höhe des Mittelschiffes. Sie sind durch Bündelpfeiler in Arkadenstellung vom Hauptschiff getrennt. Die Seitenschiffe werden durch einzelne Kapellen erweitert, eingezogene Pfeiler trennen sie voneinander. Dieser Aufbau suggeriert eine rudimentäre 5-Schiffigkeit. Die Kapellen die das Querhaus flankieren stoßen bis in die Höhe der Vorhallen desselbigen vor, sodass der Eindruck eines dreischiffigen Querhauses entsteht. Zusätzlich verschleifen sie den Übergang vom Querhausvorsprung zum Chor. Zwischen dem Chorhaus und dem Querhaus sitzt nur 1 Joch, sodass das Chorhaupt beinahe unmittelbar auf dem Querhaus aufsitzt. Dadurch entsteht ein zentralisierender Eindruck.
Die Votivkirche – Entsprechungen als Konzept
Wichtiges Moment der Votivkirche ist die allseitige Durchbrechung und gegenseitige Entsprechung des Baus. Die Vertikalteilung der äußeren Fassaden entspricht der Gestaltung des Innenraumes und entwickelt sich aus dieser. Die Triforienzone im Schiff wird weggelassen, stattdessen wird im Chor die Empore eingefügt. Dies hat eine vertikale Dreiteilung des Chorinnenraums zur Folge: Kapellenkranz, fensterlose Empore und Lichtgaden.
Die Vertikalteilung des Chores schreibt die gesamte äußere Fassadenteilung der Kirche vor. Jede Höhe dieser drei Teile hat Entsprechungen an den übrigen Fassaden, durch Gesimse und Brüstungen werden diese Verbindungen hergestellt. Die unterste Zone des Chores schließt außen mit dem Gesims des Kapellenkranzes ab. Dieses Element der Teilung setzt sich in Brüstungen über den Querhausvorhallen, in Wasserschlägen über den Kapellen des Seitenschiffs fort und bildet schließlich an der Ostfassade das Gesims unter der Skulpturgalerie. Die Chorempore entspricht in Höhe und Lage genau der Statuengalerie an der Hauptfassade. Der obere Abschluss dieser Empore läuft in Form einer Maßwerkbalustrade am Langhaus entlang und äußert sich als Bekrönung der Seitenschiffe. Der Chorabschluss wird mit der Hochschiff krönenden Maßwerkbrüstung fortgeführt und bildet so den dritten Ring.
Auch die rudimentäre 5-Schiffigkeit wird nach außen entsprechend fortgeführt und sichtbar gemacht indem die eingezogenen Strebepfeiler, welche die Kapellen bilden, nach außen nicht in einer, sondern in zwei Filialen auslaufen.
Ein zweites wichtiges Moment ist das Gegeneinanderführen und Kreuzen von horizontalen und vertikalen Tendenzen. So werden die Balustradengürtel sowie die Gesimse immer wieder von Wimpergen mit Blendmaßwerk durchstoßen. Wenn ein Gesims durch diese Wimperge gefädelt wird findet eine weitere Durchdringung statt.
Baumaterial
Der harte Sandstein, aus dem der Kirchenbau hauptsächlich besteht, stammt aus den Steinbrüchen bei Wöllersdorf sowie aus Brunn am Steinfeld.[1]
https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Votivkirche
Votivkirche
(9, Rooseveltplatz; Propsteipfarrkirche „Zum göttlichen Heiland“).
Geschichte
Erzherzog Ferdinand Max regte nach der Errettung seines Bruders Franz Joseph I. (Attentat von Johann Libenyi am 18. Februar 1853) durch einen Aufruf den Bau einer Gedächtniskirche an, die 1856-1879 nach den Plänen von Heinrich Ferstel (der bei Baubeginn erst 28 Jahre alt war) samt dem dahinterstehenden Pfarrhaus im Stil französischer Kathedralgotik des 13. Jahrhunderts auf dem Glacis vor dem Schottentor erbaut wurde. Da das Glacis damals noch nicht zur Verbauung freigegeben war, musste die Kirche am äußeren Rand desselben errichtet werden und stand damit einige Jahre später fern der Ringstraße.
Rund um den Bau der Kirche gab es eine Reihe unrealisierter Projekte: die halbkreisförmig hinter der Kirche geplante Universität Wien beziehungsweise eine Ruhmeshalle (Wiener Akropolis; realisiert im Arsenal) und das Tegetthoffdenkmal vor der Kirche.
Das Areal wurde am 25. Oktober 1855 definitiv festgelegt, am 24. April 1856 fand die Grundsteinlegung durch Kardinal-Erzbischof Rauscher statt (Gedenktafel), am 18. August 1868 feierte man die Turmvollendung. Die Weihe nahm Kardinal-Erzbischof Kutschker anlässlich der Silberhochzeit des Kaiserpaars am 24. April 1879 vor (Gedenktafel). Die Votivkirche war in der Monarchie (katholisch) Garnisonskirche für Wien (kaiserlicher Entschluss von 1862). Hier nahmen auch alle militärischen Leichenbegängnisse ihren Ausgang. Die Votivkirche ist eines der hervorragendsten Beispiele historisierender Architektur.

A.(ugust) Stauda: Rooseveltplatz – Votivkirche, um 1900.
Bildrechte: Wien Museum.
Äußeres
Doppelturmfassade mit drei Figurenportalen und Fensterrose.
Hauptportal
Hauptportal mit reichem figuralem Schmuck von Johannes Benk (Christ-König-Statue inmitten der Apostel, umgeben von Vorbildern aus dem Alten Bund [Abel, Noe, Melchisedech, Isaak, Samson, Aaron, Moses); im Giebel darüber Heilige Dreifaltigkeit (von Josef Gasser), seitlich vier Evangelisten und österreichisch-ungarische Landespatrone (Koloman [Niederösterreich], Vigilius [Südtirol], Ägydius [Kärnten], Josef [Steiermark], Leopold [Niederösterreich], Wenzel [Böhmen], Spiridion [Dalmatien], Michael [Galizien], Georg [Krain], Rochus [Kroatien], Nikolaus von Bari [Venetien], Ladislaus [Siebenbürgen], Justus [Triest], Hedwig [Schlesien], Ruprecht [Salzburg], Johannes Nepomuk [Böhmen]) von Franz Melnitzky und Peter Kastlunger), über der Rosette „Krönung Mariens“ von Gasser.
Seitenportale
Reliefs von Gasser („Verkündigung Mariens“ [darunter die vier Propheten Jeremias, Isaias, David und Michäas von Anton Schmidgruber ], „Auferstehung Christi“ [darunter Namenspatrone der kaiserlichen Familie: Franziskus, Elisabeth und Sophie von Kastlunger]).
Eingangsportale
Die Eingangsportale ins Querschiff sind Gott Vater und dem Heiligen Geist gewidmet. An den Arkadenpfeilern befinden sich acht Propheten beziehungsweise Kirchenväter. Die Kirche erhielt 1967 ein neues Dach aus Eternitplatten.
Inneres
Dreischiffige, kreuzrippengewölbte Basilika, beiderseits vier flache Seitenkapellen; dreischiffiges Querschiff; Chor mit 7/12-Schluss; Kapellenumgang und Kapellenkranz. Die Wand- und Deckengemälde stammen von Joseph von Führich, A. von Wörndle, Carl Jobst und Josef Matyáš Trenkwald. Am Deckengewölbe des Mittelschiffs Stammbaum Christi von Franz Jobst und Carl Jobst. Die Orgel (1874-1878) von E. F. Walcker & Co. (Ludwigsburg) ist das einzige mechanische Werk dieser Größe (3.762 Pfeifen) in Europa (auch Anton Bruckner hat hier gespielt).
Die Glasgemälde der Kirchenfenster, zu denen Trenkwald die Entwürfe geliefert hatte, wurden während des Zweiten Weltkriegs vernichtet und (mit Ausnahme des nach alter Vorlage erneuerten „Kaiserfensters“) durch Figuralfenster (zumeist nach Entwürfen von Christine Feldmann) ersetzt (daher finden sich bei den Ersatzfenstern auch Themen, die in die Zeit nach dem Kirchenbau fallen).
Hochaltar
Hochaltar aus weißem Marmor mit sechs ägyptischen Alabastersäulen mit figuralem Schmuck von Gasser, Robert Streschnak und Ferdinand Laufberger (Kardinaltugenden im Gewölbe des Baldachins), Bildnis der Maria, das ein Geschenk von Papst Pius IX. war, in der Mitte des (ständig gesperrten) Kapellenumgangs.
Marienaltar (einst Antwerpener Altar)
Hier stand der Antwerpener Altar (bedeutendstes Werk der flämischen Schnitzkunst des 15. Jahrhunderts; seit 1996 aus Sicherheitsgründen als Leihgabe im Dom- und Diözesanmuseum).
Thema des Kirchenfensters ist die Leidensgeschichte Christi.
„Kaiser-Fenster“
Fenster der Stadt Wien („Kaiser-Fenster“). Das Fenster wurde 1877 von der Gemeinde Wien gespendet und von dieser nach dem Zweiten Weltkrieg erneuert.
Bischofskapelle
Der Altar ist dem Göttlichen Herzen Jesu gewidmet; Grabstätte des Weihbischofs Godfried Marschall (er war der erste Propst der Kirche).
Kirchenfenster: Bischöfe der österreichischen Kirchengeschichte.
Altar der Gottesmutter von Guadelupe
Altar der Gottesmutter von Guadelupe.
Kirchenfenster: Geschichte der Verehrung des Marienbilds von Guadelupe.
Flügelaltar
Der aus Zedernholz vom Libanon geschaffene Altar zeigt die Verlobung Mariens mit dem heiligen Josef, bei geschlossenen Flügeln die Verkündigung.
Kirchenfenster: Geschichte der Verehrung des Marienbilds von Mariazell.
Barbarakerze (Artilleristen-Gedächtnisstätte).
Kirchenfenster: Geschichte des Marienbilds von Maria Pötsch.
Denkmal für die im Dienst gefallenen Angehörigen der Exekutive.
Kirchenfenster: Geschichte des wunderbaren Glasfensters von Absam (Tirol).
Kirchenfenster: Rudolf I.
Kirchenfenster: Ferdinand II.
Gotischer Kapellenschrein
Heiliges Grab für die letzten Tage der Karwoche.
Kirchenfenster: 23. Eucharistischer Kongress in Wien (1912).
Kirchenfenster: Todesstiege im nationalsozialistischen Konzentrationslager Mauthausen.
Taufkapelle
Taufstein aus ägyptischen Marmor; Hochgrab von Niklas Graf Salms (Salmgrabmal).
Kirchenfenster: Bedeutende österreichische Missionare.
Kanzel
Kanzel aus Marmor; auf dem Goldmosaik der Brüstung die vier Kirchenväter und der lehrende Heiland; am Kanzelfuß Büste Ferstels von Viktor Tilgner.
Denkmal für die österreichische Kaiserschützen-Regimenter, Kirchenfenster: Vertreter der österreichischen Sozialreform (Entwurf von Hans Schweiger).
Kreuzaltar
Kreuz-Altar.
Kirchenfenster: links Johannes von Gott (Verteidigung Wiens gegen die Türken 1529), rechts Franz Jägerstätter.
Literatur
Anton Maria Pichler: Die Votivkirche in Wien „Zum göttlichen Heiland“. Beschreibung der Geschichte, Bedeutung und Kunstwerke der Kirche. Wien: Pfarre Votivkirche „Zum Göttlichen Heiland“ 1966
Renate Wagner-Rieger [Hg.]: Die Ringstraße. Bild einer Epoche. Die Erweiterung der Inneren Stadt Wien unter Kaiser Franz Joseph. Band 1: Das Kunstwerk im Bild. Wien [u.a.]: Böhlau 1969, S 117 ff..
Renate Wagner-Rieger [Hg.]: Die Ringstraße. Bild einer Epoche. Die Erweiterung der Inneren Stadt Wien unter Kaiser Franz Joseph. Band 4: Alois Kieslinger: Die Steine der Wiener Ringstraße. Ihre technische und künstlerische Bedeutung. Wiesbaden: Steiner 1972, S. 167 ff.
Renate Wagner-Rieger [Hg.]: Die Ringstraße. Bild einer Epoche. Die Erweiterung der Inneren Stadt Wien unter Kaiser Franz Joseph. Band 8/3: Norbert Wibiral / Renata Mikula: Heinrich von Ferstel. Wiesbaden: Steiner 1974, S. 3 ff.
Bundesdenkmalamt [Hg.]: Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs. Wien. II. bis IX. und XX. Bezirk. Wien 1993, S. 382 ff.
Renate Wagner-Rieger: Wiens Architektur im 19. Jahrhundert. Wien: Österreichischer Bundesverlag 1970, S. 162 ff.
Wolfgang J. Bandion: Steinerne Zeugen des Glaubens. Die Heiligen Stätten der Stadt Wien. Wien: Herold 1989, S. 184 ff.
Moriz Thausing: Die Votivkirche in Wien. Denkschrift des Baucomités veröffentlicht zur Feier der Einweihung am 24. April 1879. Wien: Waldheim 1879
Reinhold Lorenz: Die Votivkirche als sakrales Denkmal Österreich-Ungarns. In: Franz Loidl [Hg.]: Auftrag und Verwirklichung. Festschrift zum 200-jährigen Bestand der kirchenhistorischen Lehrkanzel seit der Aufhebung des Jesuitenordens 1773. Wien: Wiener Dom-Verl. 1974 (Wiener Beiträge zur Theologie, 44), S. 275-298
Wiener Kommunal-Kalender und städtisches Jahrbuch. Wien: Gerlach & Wiedling Band 1864, S. 254 ff.
Felix Czeike: IX. Alsergrund. Wien [u.a.]: Jugend & Volk 1979 (Wiener Bezirkskulturführer, ²9), S.40 ff.
Felix Czeike: Wien. Kunst und Kultur-Lexikon. Stadtführer und Handbuch. München: Süddeutscher Verlag 1976, S. 133 ff.
Rudolf Geyer: Handbuch der Wiener Matriken. Ein Hilfswerk für Matriken-Führer und Familienforscher. Wien: Verlag d. Österr. Inst. für Genealogie, Familienrecht und Wappenkunde [1929], S. 86 (Sprengel), 251 f.(Matrikenbestanteil)
Gustav Gugitz: Bibliographie zur Geschichte und Stadtkunde von Wien. Hg. vom Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien. Band 3: Allgemeine und besondere Topographie von Wien. Wien: Jugend & Volk 1956, S. 260 f.
#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien – #Der #Prater, #Viadukt über #Prater Hauptallee, Blick vom #Praterstern
“A. & V. ANGERER’S ANSICHTEN VON WIEN.
M. Frankenstein & Cie. Phot. – Nachdruck verboten.
DER PRATER.”
Oscar Kramer, Photograph, Wien II. Leopoldstadt, Prater Hauptallee, um 1870
Veröffentlicht am Juli 14, 2014 von sparismus
“Photogr. v. Oscar Kramer in Wien.
Vervielfältigung vorbehalten.
199.
Prater (Hauptallee).
The Prater Park.
Parc Prater.”
Bereich des ehemaligen Viadukts
Praterstern, Prater Hauptallee
Praterstern, 1020 Wien
https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptallee_%28Wien%29
Die Hauptallee
(umgangssprachlich auch: Prater-Hauptallee)
ist eine etwa 4,4 km lange Allee im Wiener Prater.
Deutsch: Hauptallee im Frühling
Esperanto: Hauptallee printempe
Tokfo, 2013.
Sie führt vom Praterstern zum Lusthaus und entstand 1538 durch Schlägerungen im Auwald, um eine Verbindung zwischen dem Augarten und dem kaiserlichen Jagdgebiet im Prater herzustellen.
English: Lusthaus, Prater Hauptallee, 2nd district of Vienna
Deutsch: Lusthaus, Prater Hauptallee, Wien-Leopoldstadt
Français : Lusthaus, Prater Hauptallee, 2e district de Vienne
P e z i, Peter Haas, 2014.
Die schnurgerade Allee besteht aus der Hauptfahrbahn und beidseitigen Reitwegen und Fußgängerpromenaden.
Dazwischen wurden mehrreihig Kastanienbäume gepflanzt.
Die Hauptallee befindet sich seit der Eingemeindung der Vorstädte 1850 im 2. Wiener Gemeindebezirk, der Leopoldstadt.
Joseph Anton Nagel (1717-1804):
English: Map of Vienna approx. 1773, Detail (Praterstern). Electrically turned to show north up.
Deutsch: Karte von Wien ca. 1773, Ausschnitt (Praterstern). Per EBV gedreht (genordet).
Geschichte
Die Hauptallee verband ursprünglich
die kaiserliche Favorita im Augarten mit
dem Jagdgebiet des Hofs im Prater.
Die Allee entstand 1537/38 unter Kaiser Ferdinand I. durch Schlägerung im Prater-Auwald und wurde zeitweise
„Langer Gang“
genannt. Die Straße war ursprünglich durch den Donauarm
Heustadlwasser
in zwei Teile getrennt.
Der westliche Teil verlief vom Augarten (später nur vom Praterstern) bis zum
sogenannten ersten Rondeau,
der östliche Teil verlief
vom zweiten Rondeau zum Lusthaus.
Dazwischen musste man entlang des Südufers des Haustadlwassers gehen bzw. reiten. Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit nach dem preußisch-österreichischen Krieg 1866 wurde ein Teil des Heustadlwassers zugeschüttet und planiert, sodass die Hauptallee seit 1867 durchgängig vom Praterstern zum Lusthaus verläuft.
Das Heustadlwasser ist seither in ein „oberes“ und ein „unteres“ geteilt.
Verlauf
Deutsch: Wien Praterstern um 1900.
(rechter Hand Viadukt der Verbindungsbahn, linkerhand der Nordbahnhof)
Original image: Photochrom print (color photo lithograph)
Reproduction number: LC-DIG-ppmsc-09217 from Library of Congress, Prints and Photographs Division, Photochrom Prints Collection
Verbindungsbahn
Am Beginn der Hauptallee führte 1859 bis 1959 eine Brücke der Verbindungsbahn zwischen Nord- und Südbahnhof über die Straße und bediente zwischen Hauptallee und Ausstellungsstraße die 1900 / 1901 in Betrieb genommene Haltestelle Praterstern.
Deutsch: Wien – Brücke. Details siehe Dateiname.
Esperanto: Vieno – ponto. Por detaloj vidu la dosiernomon.
Kortz, Paul , ed. (in Deutsch) (1905) Wien am Anfang des XX. Jahrhunderts – Ein Führer in technischer und künstlerischer Richtung, Verlag von Gerlach & Wiedling Retrieved on 2. November 2013.
Die Bahnverbindung wurde in den 1950er Jahren bis 1959 auf den vergrößerten und umgebauten Praterstern verlegt, wo der Bahnhof Wien Praterstern heute, mittlerweile auch von zwei U-Bahn-Linien angefahren, einer der wichtigsten Regionalverkehrsknoten Wiens ist.
Bei der Neugestaltung des Pratersterns wurde damals ein großer Kreisverkehr angelegt, dem etwa 400 m der Hauptallee (ursprünglich 4,8 km lang) zum Opfer fielen.
Der Praterstern war von der Altstadt seit 1868 mit der Pferdetramway erreichbar.
Wurstelprater
Auf den ersten 700 m der Hauptallee grenzt nördlich seit den 1770er Jahren der Wurstelprater, Wiens großer Vergnügungspark, an die Hauptallee, die, wie der ganze Prater, von Kaiser Joseph II. 1766 für die Öffentlichkeit freigegeben wurde. Unweit der Allee befinden sich das 1897 errichtete Riesenrad und das 1964 eröffnete Planetarium der Stadt Wien. (Vor 1945 reichte der Vergnügungspark dichter an die Hauptallee heran.)
Nach 1786 wurden an der Hauptallee vor der Waldsteingartenstraße in geringer Entfernung voneinander an der nördlichen Straßenseite drei Kaffeehäuser eingerichtet, die Erstes, Zweites und Drittes Kaffeehaus hießen. Sie waren populäre Ausflugsziele. 1814 spielte Ludwig van Beethoven, 1824 Joseph Lanner im 1. Kaffeehaus; später spielten Tanzkapellen, wie etwa die von Johann oder Eduard Strauß, auf.
Rotunde
Endstation Prater Hauptallee der Straßenbahnlinie 1 bei der Rotundenallee
Vom Praterstern etwa 1,1 km entfernt, befindet sich neben dem 1873 südlich der Hauptallee entstandenen Konstantinhügel bei der Kreuzung der Hauptallee mit Rotundenallee und Kaiserallee die Endstation der zuvor über Ringstraße und Franz-Josefs-Kai verkehrenden Straßenbahnlinie 1 (die Strecke wurde zuvor seit 1873 von einer Pferdebahnlinie befahren). Nördlich befand sich unweit der Hauptallee 1873–1937 die zur Weltausstellung 1873 errichtete Rotunde, ein riesiges Ausstellungsgebäude, an dessen Stelle nun der Neubau der Wirtschaftsuniversität Wien fertiggestellt wurde.
Stadion
Etwa 2,3 km vom Praterstern entfernt, liegt nordöstlich nahe der Allee das 1931 eröffnete Praterstadion (oder schlicht Stadion), seit 1992 auch Ernst-Happel-Stadion genannt. Direkt an die Hauptallee grenzen die Liegewiesen des 1931 eröffneten Stadionbads. Bei der Stadionallee kreuzen die Hauptallee städtische Autobuslinien.
Heustadelwasser
Der etwa 1,3 km lange Mittelteil zwischen dem ersten (Kreuzung mit Stadionallee und Meiereistraße, 2,3 km vom Praterstern) und dem zweiten Rondeau (Einmündung der Lusthausstraße, 3,6 km vom Praterstern) wurde erst 1867 angelegt; bis dahin verlief der Weg zum Lusthaus etwa dort, wo sich heute die Lusthausstraße befindet: in einem Bogen südwärts entlang des Südufers des Heustadelwassers, bis 1875 ein Donauarm, der die gerade Linie der Hauptallee zweimal kreuzte.
Etwa 3,1 km vom Praterstern quert seit 1970 die sechsspurige, Südosttangente genannte Stadtautobahn A23 die Hauptallee (und das Heustadelwasser) in Hochlage. Die heute meistfrequentierte Autobahn Österreichs wurde über einen zuvor besonders stillen Teil des Grünen Praters geführt. Zur Hauptallee besteht keine Verbindung.
Ostbahnbrücke
Etwa 200 m vor dem Ende der Hauptallee beim Lusthaus führt seit 1870 eine Brücke der Ostbahn über die Straße. Über sie verkehren S-Bahn- und Regionalzüge ins nördliche und östliche Niederösterreich sowie Züge Richtung Brünn, Prag, Krakau und Pressburg.
Nutzung
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war die Allee beliebtes Ausflugsziel des Wiener Adels, der hier im Sommer mit seinen Kutschen ausfuhr; es sind Tage dokumentiert, an denen rund 1.200 herrschaftliche Kutschen durch die Allee verkehrten und bei der Rückfahrt ins Stadtzentrum Verkehrsstaus verursachten. Veranstaltungen wie das Lauferrennen, ein Wettrennen der herrschaftlichen Laufer, das allerdings im Revolutionsjahr 1848 verboten wurde, fanden hier statt. Bevor die Trabrennbahn Krieau errichtet wurde, fanden die Pferderennen auf der Hauptallee statt.
Ab 1886 veranstaltete Fürstin Pauline von Metternich den Blumenkorso. Für die Arbeiter war die Hauptallee nach Erstarken der Arbeiterbewegung ein beliebter Aufmarschplatz: Der erste Maiaufmarsch Österreichs fand, in ganz Europa beachtet, am 1. Mai 1890 hier statt, 1897 wurde ein Radfahrer-Blumenkorso veranstaltet. 1903 gab es das erste Automobilrennen in der Hauptallee.
In der Zwischenkriegszeit wurde die Hauptallee vom Automobil erobert. Auf der langen Geraden konnte man die Freuden des Herrenfahrers ausleben. Seit Juni 1964 ist der private Autoverkehr in der Hauptallee größtenteils untersagt; Ausnahmen wurden gelegentlich für Großveranstaltungen im Stadion bewilligt. Heute ist die Prater-Hauptallee eine öffentliche Freizeitanlage für Radfahrer, Fußgänger, Läufer (z. B. beim jährlichen Vienna City Marathon), Fiaker, Rikschafahrer und Reiter. Bei ausreichender Schneelage wird die Hauptallee von Schilangläufern benützt.
https://www.wien.gv.at/wiki/index.php?title=Hauptallee
Hauptallee (2, Prater).
Prater-Hauptallee beim Praterstern mit Verbindungsbahnbrücke, um 1904/05.
Prater-Hauptallee, um 1899; aus Richtung Praterstern südostwärts gesehen.
Am Praterstern beginnend und beim Lusthaus (ursprünglich ein bereits vor 1566 bestehendes kleines Jagdschlösschen, das 1781-1783 durch den heutigen Bau ersetzt wurde) unweit des Rennplatzes und der Freudenau endend,
ist die Allee unter Ferdinand II. 1537/1538 durch Schlägerung im Praterauwald entstanden („Langer Gang“) und stellte die Verbindung von der kaiserlichen Favorita im Augarten zum Jagdgebiet des Hofs im Prater her.
Ursprünglich verlief die Straße nur bis zum ersten Rondeau geradlinig, dann jedoch entlang des (heutigen) Heustadelwassers (bis zur Donauregulierung ein Donauarm) bis zu dessen Kreuzung mit der direkten Linie Praterstern – Lusthaus beim zweiten Rondeau.
Die Hauptallee durchzieht den Prater in einer Länge von heute 4,5 Kilometer (bis zum Umbau des Pratersterns in den 1950er Jahren waren es 4,8 km) und war ab dem 18. Jahrhundert die schönste Korsostraße für die Wagenausfahrten des Hofs sowie der Angehörigen des Adels und des wohlhabenden Großbürgertums, wobei dem 1. Mai als Auftakt der Saison besondere Bedeutung zukam. Das Zusammenströmen der vornehmen Welt motivierte vor allem Cafetiers, in der Hauptallee Lokalitäten zu eröffnen.
Um 1786 entstanden kurz nacheinander drei Praterkaffeehäuser, die der Einfachheit halber, entsprechend ihrer räumlichen Abfolge vom Praterstern aus, als Erstes, Zweites und Drittes Kaffeehaus bezeichnet wurden.
Das Erste Kaffeehaus wurde durch seine Veranstaltungen bekannt (1814 spielte Beethoven [es war sein letztes öffentliches Auftreten als Klaviervirtuose], 1824 konzertierte hier Lanner); das Zweite Kaffeehaus war eine Gründung des bekannten Cafetiers Johann Evangelist Milani und gehörte im Vormärz Ignaz Wagner, dem Vater der Lebensgefährtin Ferdinand Raimunds, Antonie; das Dritte Kaffeehaus lockte im Vormärz auch deshalb Besucher an, weil es ein Laboratorium beherbergte, in dem aus dem Saft von Ahornbäumen Zucker hergestellt wurde, wogegen im späteren 19. Jahrhundert Anton Ronacher hier ein Sommertheater betrieb.
Auch zahlreiche Veranstaltungen wurden in der Hauptallee abgehalten; so werden in den Eipeldauer-Briefen (unter anderem 1794) Stafettenläufe erwähnt; bis 1847 fanden in der Hauptallee auch die Lauferrennen statt (Wettrennen der herrschaftlichen Laufer, die 1848 wegen „Unmenschlichkeit“ verboten wurden). Gegen Ende des Vormärzes (nach 1830) wurden in der Hauptallee Trabfahrten abgehalten, vor allem fanden jedoch in der Hauptallee am 1. Mai die berühmten „Praterfahrten“ statt, bei denen es zu respektablen Wagenauffahrten und am Abend zu entsprechenden Verkehrsstauungen bei der Rückfahrt in die Stadt kam (man zählte bis zu 1.200 Equipagen, die an der Auffahrt teilnahmen); bei dieser Gelegenheit wurde auch die Mode für die kommende Saison kreiert.
Auch Festivitäten verschiedenster Art wurden in die Hauptallee verlegt: unter anderem fand hier am 29. April 1854 anlässlich der Vermählung Kaiser Franz Josephs ein „Kaiserfest“ statt. 1866/1867 wurde das zwischen erstem und zweitem Rondeau liegende Stück der Hauptallee als „Notstandsarbeit“ (Arbeitslosigkeit nach dem preußisch-österreichischen Krieg 1866) planiert und trassiert, sodass seither die Hauptallee in gerader Linie bis zum Lusthaus führte (bis dahin Verbindung entlang des Heustadelwassers).
Ab 1860 fanden in der Hauptallee Trabrennen statt. 1870 gab es eine Fiakerwettfahrt. 1871/1872 wurde der Volksprater „reguliert“ (Mitwirkung von Architekt Lothar Abel), 1873 wurde nahe der Hauptallee als zentrales Gebäude des Weltausstellungsgeländes die Rotunde errichtet; der Aushub der Weltausstellungsbauten wurde nahe der Hauptallee zum Konstantinhügel aufgeschüttet.
Der 1873 gegründete „Wiener Trabrenn-Verein“ veranstaltete sein erstes Trabrennen in der Hauptallee am 29. Mai 1874; weitere folgten, bis 1878 der Trabrennplatz eröffnet wurde. Am 29. / 30. Mai 1886 arrangierte Pauline Fürstin Metternich den ersten Blumenkorso. Die Etablierung politischer Parteien und der Kampf um das allgemeine Wahlrecht, der nach dem Hainfelder Einigungsparteitag der Sozialdemokraten (1888/1889) in ein neues Stadium trat, sowie die Einführung des 1. Mais als Arbeiterfeiertag hatten zur Folge, dass ab 1890 an diesem Tag die Arbeiterschaft in den Prater marschierte und dort vornehmlich auf der Hauptallee promenierte (Maifeier), bis die Maiaufmärsche in den 1920er Jahren auf die Ringstraße verlegt wurden; in logischer Konsequenz wurde als Pendant zum Kutschenblumenkorso des Adels und der Bürger in der Hauptallee ein Radfahrerblumenkorso der Arbeiter veranstaltet (erstmals am 26. Mai 1897).
1903 wurde zum Abschluss der Fernfahrt Paris-Wien in der Hauptallee eine Autowettfahrt abgehalten. 1925 fand eine „Praterfahrt von einst“ statt, zugleich auch der erste Autoblumenkorso.
1964 wurde der Autoverkehr in der Hauptallee großteils verboten.
Siehe Hauptallee in Wikipedia.
Pfarrzugehörigkeit bis 1938
Bis 1938 lag die Standesführung in Österreich in den Händen der konfessionellen Behörden. Die Geburts-, Ehe-, und Sterbematriken von katholischen Bewohnerinnen und Bewohnern wurden von der zuständigen Pfarre geführt.
ab 1878: Pfarre St. Johann
ab 1921: bis zur Ostbahnlinie Grenze zwischen Pfarre St. Johann (im Südwesten) und Pfarre Donaustadt (im Nordosten); von Ostbahnlinie bis Lusthaus: Pfarre Donaustadt
Literatur
Felix Czeike: II. Leopoldstadt. Wien [u.a.]: Jugend & Volk 1980 (Wiener Bezirkskulturführer, 2), S. 64 f.
Felix Czeike: Leopoldstadt und Brigittenau. Zaltbommel: Europäische Bibliothek 1992 (Wien in alten Ansichtskarten), Abb. 55-58, Abb. 86-87
Die Leopoldstadt. Ein Heimatbuch. Wien: Lehrer-Arbeitsgemeinschaft 1937, S. 328
Rudolf Geyer: Handbuch der Wiener Matriken. Ein Hilfswerk für Matrikenführer und Familienforscher. Wien: Verlag des Österreichischen Instituts für Genealogie, Familienrecht und Wappenkunde, 1929
Ferdinand Lettmayer [Hg.]: Wien um die Mitte des XX. Jahrhunderts – ein Querschnitt durch Landschaft, Geschichte, soziale und technische Einrichtungen, wirtschaftliche und politische Stellung und durch das kulturelle Leben. Wien: 1958, S. 104 f.
Hans Pemmer / Ninni Lackner: Der Prater. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wien, München: Jugend & Volk 1974 (Wiener Heimatkunde), S. 146 ff.
http://prater.topothek.at/#doc=22690
Fundgrube für Detailfreudige
Blick über den Nordbahnhof gegen die Rotunde
Weitere Beispiel von
“Michael Frankenstein – Fotograf in Wien”
“Victor Angerer – Fotograf in Wien und Ischl”
“Kunsthandlung V. & A. ANGERER in Wien”
auf Sparismus:
Victor Angerer, Photograph in Wien und Ischl, k.u.k. Aussenminister Friedrich Ferdinand Graf von Beust, 1866
https://sparismus.wordpress.com/2016/07/03/victor-angerer-photograph-in-wien-und-ischl-k-u-k-aussenminister-friedrich-ferdinand-graf-von-beust-1866/
Victor Angerer, Fotograf, Bad #Ischl vis a vis der #Esplanade, unbekannter Jungmann, stehend an Tisch, weisser Zylinder auf Sitz, 1868
https://sparismus.wordpress.com/2016/10/13/victor-angerer-fotograf-bad-ischl-vis-a-vis-der-esplanade-unbekannter-jungmann-stehend-an-tisch-weisser-zylinder-auf-sitz-1868/
Victor Angerer, Photograph in Bad #Ischl, belebter #Nepomukbrunnen am #Kreuzplatz, um 1870
https://sparismus.wordpress.com/2016/10/12/victor-angerer-photograph-in-bad-ischl-belebter-nepomukbrunnen-am-kreuzplatz-um-1870/
A. & V. Angerer, Kunsthandlung, Wien I., Innere Stadt, Kärntnerstrasse 51, sv, #39, Blick über Donau auf Leopoldsberg, Drahtseilbahn, um 1873 https://sparismus.wordpress.com/2015/05/24/a-v-angerer-kunsthandlung-wien-i-innere-stadt-karntnerstrasse-51-sv-39-blick-uber-donau-auf-leopoldsberg-drahtseilbahn-um-1873/
August Angerer, Michael Frankenstein, Wien I. Innere Stadt, Schwarzenbergplatz 1, Palais Erzherzog Ludwig Viktor, 1873.
https://sparismus.wordpress.com/2015/07/29/august-angerer-michael-frankenstein-wien-i-innere-stadt-schwarzenbergplatz-1-palais-erzherzog-ludwig-viktor-1873/
August & Viktor Angerer, Kunsthandlung, Wien, Stadt, Kärntnerstrasse 51, Stephanskirche, Steffl, Lazanskyhaus mit Attika-Figur, um 1873 https://sparismus.wordpress.com/2015/12/15/august-viktor-angerer-kunsthandlung-wien-stadt-kaerntnerstrasse-51-stephanskirche-steffl-lazanskyhaus-mit-attika-figur-um-1873/
#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien – #Der #Prater, #Viadukt über #Prater Hauptallee, Blick vom #Praterstern
https://sparismus.wordpress.com/2018/05/16/michael-frankenstein-august-und-victor-angerer-in-wien-der-prater-viadukt-ueber-prater-hauptallee-blick-vom-praterstern/
#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien, 1873 – #Lazaristenkirche mit #Friedhof, #Neubau, Blick vom #Europaplatz, #Westbahnhof
https://sparismus.wordpress.com/2018/05/08/michael-frankenstein-august-und-victor-angerer-in-wien-1873-lazaristenkirche-mit-friedhof-neubau-blick-vom-europaplatz-westbahnhof/
#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien, 1873 – Neues #Musikvereinsgebäude, #Musikvereinsplatz 1
https://sparismus.wordpress.com/2018/05/29/michael-frankenstein-august-und-victor-angerer-in-wien-1873-neues-musikvereinsgebaeude-musikvereinsplatz-1/
#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien – #Weissgerberkirche, Blick vom #Kolonitzplatz zur #Löwenstrasse
https://sparismus.wordpress.com/2018/05/01/michael-frankenstein-august-und-victor-angerer-in-wien-weissgerberkirche-blick-vom-kolonitzplatz-zur-loewenstrasse/
#Michael #Frankenstein, #August und #Victor #Angerer in #Wien, 1873 – #Votivkirche, #Maximilianplatz, #Freiheitsplatz, #Dollfussplatz, #Hermann-#Göring-Platz, #Rooseveltplatz
https://sparismus.wordpress.com/2018/05/22/michael-frankenstein-august-und-victor-angerer-in-wien-1873-votivkirche-maximilianplatz-freiheitsplatz-dollfussplatz-hermann-goering-platz-rooseveltplatz/
#Michael #Frankenstein et #August #Angerer in #Wien – #Prater – #Weltausstellung 1873 – #Konstantinhügel mit #Sacher’s Restauration “Am Hügel”
https://sparismus.wordpress.com/2018/04/04/michael-frankenstein-et-august-angerer-in-wien-prater-weltausstellung-1873-konstantinhuegel-mit-sachers-restauration-am-huegel/
#August und #Victor #Angerer in #Wien – #Prater – #Weltausstellung 1873 – #Konstantinhügel mit #Sacher’s Restauration “Am Hügel”
https://sparismus.wordpress.com/2018/03/23/august-und-victor-angerer-in-wien-prater-weltausstellung-1873-konstantinhuegel-mit-sachers-restauration-am-huegel/
Victor Angerer, Fotograf in #Wien, 87, um 1880, weidende Kühe an einem Weiher mit Pappelallee
https://sparismus.wordpress.com/2017/09/14/victor-angerer-fotograf-in-wien-87-um-1880-weidende-kuehe-an-einem-weiher-mit-pappelallee/
Mag. Ingrid Moschik – Spurensicherung “IM NAMEN DER REPUBLIK”