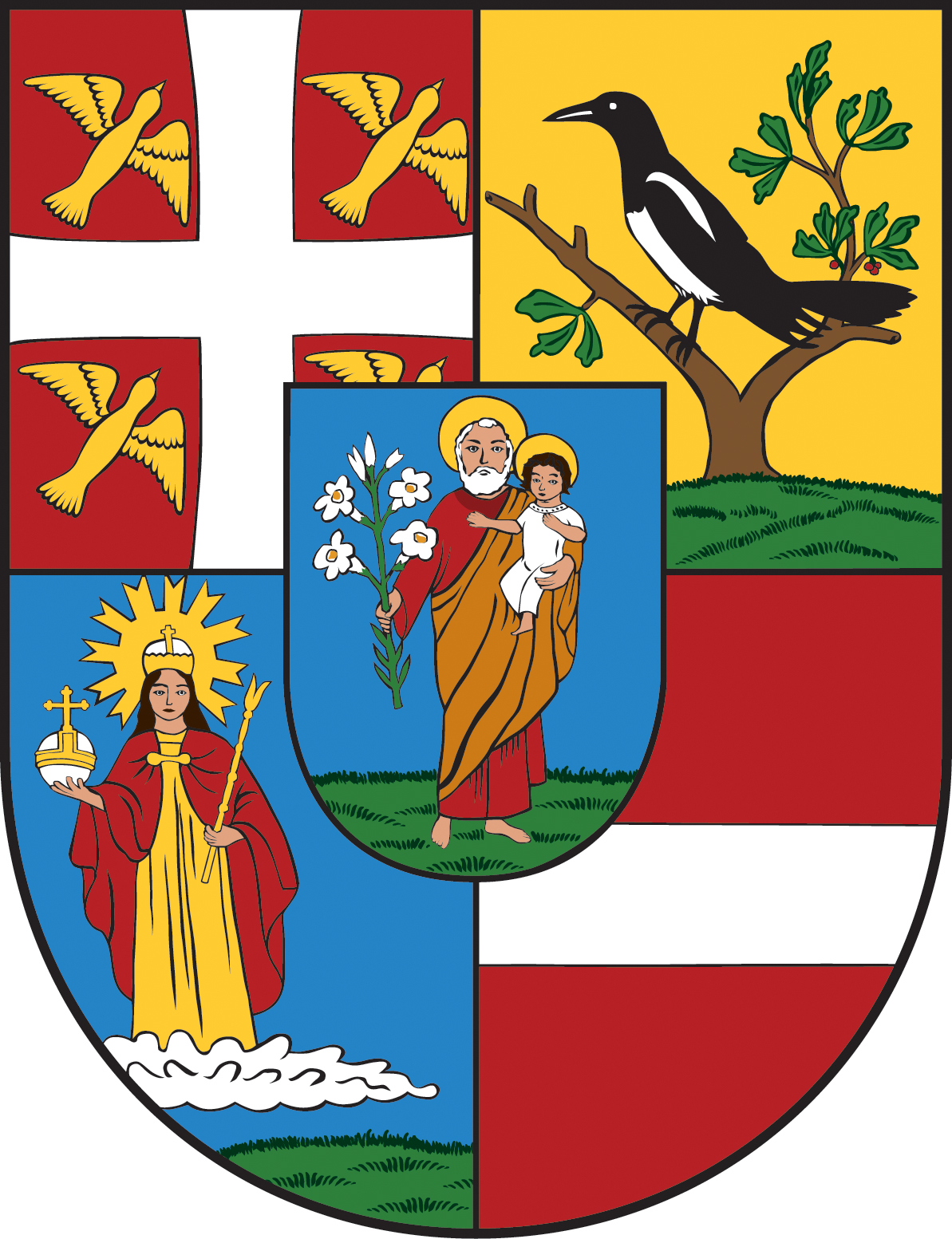![W. Burger, Wilhelm Burger, Wilhelm Joseph Burger (1844 Wien – 1920 Wien), Maler und Photograph in Wien, S. Sonnenthal, Samuel Sonnenthal (aktiv um 1868 bis um 1892 in Wien), Photograph, Photoverleger und Kunsthändler in Wien, Wien I. Innere Stadt, Graben, Pestsäule (1679-1692), Josefsbrunnen (1638-1804), The Austrian Federal Chancellery, Bundeskanzleramt Österreich, BKA, Ballhausplatz 2, Sparismus, Sparen ist muss, Sparism, sparing is must Art goes politics, Zensurismus, Zensur muss sein, Censorship is must, Mag. Ingrid Moschik, Mündelkünstlerin]()
“Nach d. Natur ph.
CABINET-PHOTOGRAPHIE.
von Wilhelm Burger.”
W. Burger
Wilhelm Burger
Wilhelm J. Burger
Wilhelm Joseph Burger (1844 Wien – 1920 Wien)
österreichischer Landschafts- und Expeditionsphotograph
“August 1871.
Graben, mit der Pestsäule
in Wien”
“S. SONNENTHAL
KUNSTHÄNDLER
WIEN”
S. Sonnenthal
Samuel Sonnenthal (aktiv um 1868 bis um 1892 in Wien)
Bruder von Adolf Sonnenthal (1834 Pest – 1909 Prag)
östereichischer Photograph, Photoverleger, Kunsthändler in Wien
http://sammlungenonline.albertina.at/?id=starl_1A2E45B3B09448808115E9B80E6B65C8#83b2866a-2351-42d1-98f2-44107f717baa
Künstler/Verfasser Burger, Wilhelm
Biografische Angaben
biografischer Abriss
1844 – 1920
“(1844-1920) Maler, Fotograf, Fotolehrer.
Geb. in Wien,
1855-1860 Schüler an der Akademie der bildenden Künste in Wien, dann bei Ferdinand Piloty (1828-1895) in München,
lernte die Fotografie bei seinem Onkel A. v. Ettingshausen (s.d.),
1863-1867 fotografische Lehrtätigkeit am physikalischen Institut der Universität Wien,
1866-1868 lebte B. teilweise in Aussee,
1868-1870 Teilnahme an der österreichischen Ostasien-Expedition, die K. v. Scherzer (s.d.) leitete,
1871 Hoftitel,
1872 Teilnahme an arktischer Expedition nach Nowaja Semlja, an der auch Graf Wilczek (s.d.) teilnahm,
1874 Atelier in Wien,
1876 Teilnahme an archäologischer Expedition nach Samothrake,
1881 nach Kleinasien, fotografische Ausrüstung weiterer Expeditionen,
1905 u.
ab 1907 Redaktion der Zs. “Photographische Korrespondenz‘,
gest. in Wien.
— Führender österreichischer Expeditionsfotograf im 19. Jahrhundert, fotografierte überwiegend Landschaft und Bevölkerung der bereisten Gebiete, verwendete u. propagierte das Tannin-Trockenverfahren, in den 60er u. 70er Jahren fotografierte B. Ansichten von Wien, dem Salzkammergut u. der Steiermark, später eine Dokumentation der Burg Kreuzenstein.“ in: Otto Hochreiter, Timm Starl, “Lexikon zur österreichischen Fotografie“, in: Geschichte der Fotografie in Österreich, Band 2, hrsg. von Otto Hochreiter und Timm Starl im Auftrag des Vereins zur Erarbeitung der Geschichte der Fotografie in Österreich, Ausst.-Kat., Bad Ischl 1983, 93-209, 107
Schlagwort
Fotolehrer, Expedition, Atelierfotograf, Archäologie, Fotoausrüstung, Fotozeitschrift, Landschaft, Stadt, Architektur, Verfahren
Künstler
schließen
Ort / Land: Ostasien
zuletzt bearbeitet: 2001-12-01
1844 – 1920
Wilhelm J. Burger, geb. 15. März 1844 in Wien, gest. 7. März 1920 in Wien
Quelle: Welt ausstellen. Schauplatz Wien 1873, Ausst.-Kat. Technisches Museum, Wien 2004, 107
zuletzt bearbeitet: 2004-11-17
Atelier/Wohnung/lebt in
um 1865 – 1919
als Landschaftsfotograf in Aussee und Umgebung (um 1865),
Atelier in Wien, Bauernmarkt 7 (Herbst 1868, Herbst 1870, 1873, 1874),
Wien I., Am Hof 3 (1879, 1884),
Wien I., Herrengasse 5, “Excellenz Gräflich Wilczek’sches Palais“ (1889),
Herrengasse 5 (1890, 1894, 1899, 1918, Gewerberücklegung ca. März/Juni 1919)
Quelle: “Fotografen Wien’s und Umgebung“, in: Marneau’s Fotografie-Almanach, 1869, 40-45, 40 (Herbst 1868); Biographisches Lexikon der österreichischen Photographen 1860 bis 1900, Zusammengestellt von Hans Frank, Typoskript, o.O. 1980, 137 (Aussee, vor 1870); “Fotografen Wien’s und Umgebung“, in: Marneau’s Fotografie-Almanach, 1871, 44-49, 44 (Herbst 1870); “Fotografen Wien’s und Umgebung“, in: Marneau’s Fotografie-Almanach 1873, 52-58, 52; “Mitglieder der photographischen Gesellschaft in Wien (Dritte, revidirte Ausgabe vom 20. März 1874)“, in: Photographisches Jahrbuch für 1874, 117-124, 117; Lehmann’s Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger neben Handels- und Gewerbe-Adreßbuch für die k.k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien und Umgebung, 13. Jg., 1875, Wien: Alfred Hölder [www.digital.wienbibliothek.at], 847; Antiquariat Timm Starl, Visitkartfotografie 1860 – 1900, Kat. 8, Frankfurt am Main 1979, 94 (1889); Lehmann’s Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger neben Handels- und Gewerbe-Adreßbuch für die k.k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien und Umgebung, 27. Jg., 1885, Wien: Alfred Hölder, 1360; Lehmann’s Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger neben Handels- und Gewerbe-Adreßbuch für die k.k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien und Umgebung, 32. Jg., 1890, Wien: Alfred Hölder [www.digital.wienbibliothek.at], 1525; “Photographische Gesellschaft in Wien. [...] Mitgliederverzeichnis“, in: Kalender für Photographie und verwandte Fächer, 1894, 111-125, 112; Lehmann’s Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für die k.k. Reichs-Haupt- und Residenzstadt Wien nebst Floridsdorf und Jedlersdorf, 1900, 42. Jg., Bd. 1, Wien: Alfred Hölder, o.J., 748; Lehmanns Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger nebst Handels- und Gewerbe-Adreßbuch für die k.k. Reichs-Haupt- und Residenzstadt Wien, 1914, 56. Jg., Bd. 2, Wien: Alfred Hölder, o.J., 1347; Lehmanns Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger nebst Handels- und Gewerbe-Adreßbuch für die k.k. Reichs-Haupt- und Residenzstadt Wien, 1918, 60. Jg., Bd. 1, Wien: Alfred Hölder, o.J., 1299; Der Bund. Monatsschrift für die Interessen der österreichischen Berufsphotographen. Amtsblatt des Reichsverbandes und der Genossenschaften der Photographen in Wien, für Steiermark in Graz, [...], für Nordtirol in Innsbruck, hrsg. vom Reichsfachverbande der Photographen-Genossenschaften Österreichs in Wien, redigiert von Silver Frey, verantwortlich für die Schriftleitung W. Weis, Heft 1, Juli 1918, Heft 2 Dez. 1918, Heft 3 Jan. 1919, Heft 4 Feb. 1919, Heft 5-6 Juni 1919 (letztes Heft), 58
Schlagwort
Landschaft
Ort / Land: Steiermark, Bad Aussee
zuletzt bearbeitet: 2012-07-17
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Burger_(Fotograf)
Wilhelm J. Burger
(* 15. März 1844 in Wien; † 7. März 1920 ebenda) war ein österreichischer Fotograf, der sich hauptsächlich als Landschaftsfotograf betätigte. [1]
Leben
Wilhelm Burger erhielt seine Ausbildung als Maler an den Kunstakademien in Wien und München.
Später war er ein Schüler von Constantin von Ettingshausen und lehrte von 1864 bis 1866 an der Universität Wien Photographie.
1865 trat er der Photographischen Gesellschaft in Wien bei.
1868 bis 1870 war Burger auf der kommerziell wissenschaftlichen Expedition in Ostasien. Seine, bei diesen Anlässen gemachten, Aufnahmen gelten als besonders schöne Beispiele für Arbeiten mit Tannin-Trockenplatten.
1871 wurde Burger k.k. Hof–Photograph.
1872 segelte er mit Graf Wilczek auf der “Isbjörn” zu den Inseln bei Nowaja Semlja, wo er mit der S/X Admiral Tegetthoff, dem Schiff der Polarexpedition, zusammentraf. Von diesem Treffen fertigte er eine Serie mit Stereoskopbildern an, die das Leben an Bord sowie die einzelnen Expeditionsteilnehmer darstellen. Burger verwendete auch damals seine daheim angefertigten Tannin-Trockenplatten. Er arbeitete aber auch schon mit dem Kollodium–Verfahren und mit Papiernegativen. Diese waren, anders als die Tannin–Trockenplatten, auch noch zehn Tage nach dem Präparieren brauchbar.
Auch Graf Wilczek photographierte auf dieser Expedition.
1881 verwendete Burger auf seiner Expedition nach Lykien und Karien bereits Gelatine–Emulsions-Platten. Durch die Erfindung der Trockenplatte wurde es nun möglich, dass auf Expeditionen auch Amateure photographieren konnten.
1882 setzte sich Burger dafür ein, dass auf wissenschaftlichen Expeditionen Trockenplatten verwendet werden. Bezüglich der Ausrüstung, die er empfahl, verwies er auf seine fünfzehnjährige Praxis. In der Photographischen Correspondenz schrieb er in diesem Jahr ausführlich darüber, empfahl das handliche Format 15 x 21 cm und berechnete das nötige Gewicht der Ausrüstung. Eine Aufnahme veranschlagte er mit einem Kilogramm. Er ging von zweihundert mitzunehmenden Platten mit den dazugehörigen Utensilien aus. Für den Transport waren entweder drei Pferde oder ein Kamel und ein Pferd notwendig.
Um 1900 fotografierte Burger für Graf Wilczek die Burg Kreuzenstein und verwendete bei einer Nachtaufnahme der Burg dreihundert Einzelblitze.
1905 wurde er kaiserlicher Rat.
Kritik
Eine Bildserie aus Thailand, die jahrelang Burger zugeschrieben wurde, erwies sich später als Arbeit des thailändischen Hoffotografen Francis Chit auf Thai u.a. Khunsunthonsathitlak. Im 2012 erschienenen Buch von Donko, Wilhelm M.: “Auf den Spuren von Österreichs Marine in Siam (Thailand)” belegt der Autor auf S.144-162, dass der überwiegende Teil der Siam-Fotografien von Wilhelm Burger aus 1869 in Wahrheit von Francis Chit stammt. Bezüglich Japan haben Akiyoshi, Tani und Pantzer, Peter im Artikel “Wilhelm Burger’s Photographs of Japan: New Attributions of his Glass Negative Collection in the Austrian National Library.” in der Zeitschrift „Photo Researcher Nr. 15/2011“ nachgewiesen, dass ein erheblicher Teil der Japan-Fotografien aus 1869 nicht von Wilhelm Burger aufgenommen wurde. Der Hintergrund seiner China-Fotografien von der Ostasien-Expedition 1869 wurde noch nicht näher in diesem Lichte untersucht.
[2]
Literatur
Der Geraubte Schatten: eine Weltreise im Spiegel der ethnographischen Photographie, Thomas Theye, Münchner Stadtmuseum, C.J. Bucher, 1989, S. 56
Neue Arbeiten:
Akiyoshi, Tani/ Pantzer, Peter: “Wilhelm Burger’s Photographs of Japan: New Attributions of his Glass Negative Collection in the Austrian National Library.” In: „Photo Researcher Nr. 15/2011“, hgg. von der Europäischen Gesellschaft für die Geschichte der Fotografie (ESHPh)
Donko, Wilhelm M.: “Auf den Spuren von Österreichs Marine in Siam (Thailand)” , Berlin 2012 (S.144-162)
http://austria-forum.org/af/AEIOU/Burger,_Wilhelm_J.
Burger, Wilhelm J.
* 15. 3. 1844, Wien
† 7. 3. 1920, Wien
Maler und Fotograf
Studierte 1855-60 an der Akademie der bildenden Künste in Wien, lernte die Fotografie bei seinem Onkel Andreas Freiherr von Ettingshausen. Führender österreichischer Expeditionsfotograf des 19. Jahrhunderts (unter anderem Arktis-Expedition 1872).
Literatur:
G. Rosenberg, W. Burger, Ein Welt- und Forschungsreisender mit der Kamera, 1844-1920, 1984
http://www.bildarchivaustria.at/Pages/Praesentation.aspx?p_iAusstellungID=12668818
Wilhelm Burger
Berühmter österreichischer Expeditionsfotograf des 19. Jahrhunderts (1868-1870 Teilnahme an der österreichischen Ostasien-Expedition, 1872 Teilnahme an arktischer Expedition nach Nowaja Semlja), großteils topographische und ethnographische Aufnahmen.
http://sammlungenonline.albertina.at/Default.aspx#770b5b4f-1955-454b-9ed2-c186a4ee1231
Künstler/Verfasser Sonnenthal, Samuel
Biografische Angaben
biografischer Abriss
um 1868 – um 1892
“(aktiv um 1868-1892) Fotoverleger.
Betrieb einen Porträt- u. Kunstverlag in Wien,
der u.a. Ansichten von Wien
u. eine Serie mit fotografierten Schauspieler-Karikaturen herausbrachte.
— Bekannter Wiener Fotoverleger.“
in: Otto Hochreiter, Timm Starl, “Lexikon zur österreichischen Fotografie“, in: Geschichte der Fotografie in Österreich, Band 2, hrsg. von Otto Hochreiter und Timm Starl im Auftrag des Vereins zur Erarbeitung der Geschichte der Fotografie in Österreich, Ausst.-Kat., Bad Ischl 1983, 93-209, 181
Schlagwort
Fotoverlag, Stadt, Prominenz
zuletzt bearbeitet: 1996-04-02
Verwandtschaft
nach 1868
Bruder des berühmten Burgtheater-Schauspielers Adolf Sonnenthal
Quelle: Biographisches Lexikon der österreichischen Photographen 1860 bis 1900, Zusammengestellt von Hans Frank, Typoskript, o.O. 1980, 113
zuletzt bearbeitet: 1999-01-02
Atelier/Wohnung/lebt in
1868 – 1892
“Portrait- u. Kunstverlag“ in Wien I., Kärntnerstraße 16 (1868),
dann I., Michaelerplatz 2 (bis1889),
danach Michaelerplatz 4 (1869, bis 1892)
Quelle: Biographisches Lexikon der österreichischen Photographen 1860 bis 1900, Zusammengestellt von Hans Frank, Typoskript, o.O. 1980, 113; Lehmann’s Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger neben Handels- und Gewerbe-Adreßbuch für die k.k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien und Umgebung, 8. Jg., 1870, Wien: Verlag der Beck’schen Universitäts-Buchhandlung (Alfred Hölder), 650; Untersatzkarton a.R. (um 1870); Lehmann’s Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger neben Handels- und Gewerbe-Adreßbuch für die k.k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien und Umgebung, 8. Jg., 1870, Wien: Verlag der Beck’schen Universitäts-Buchhandlung (Alfred Hölder), 650
Schlagwort
Atelierfotograf, Fotoverlag
zuletzt bearbeitet: 2007-01-22
Aktivität/en
um 1870 – um 1880
verlegt u.a. zahlreiche Porträts von Schauspielern im Visitformat,
von Julius Gertinger aufgenommen und teilweise koloriert
Quelle: Biographisches Lexikon der österreichischen Photographen 1860 bis 1900, Zusammengestellt von Hans Frank, Typoskript, o.O. 1980, 10
Schlagwort
Porträt, Prominenz, Kolorierung, Fotoverlag
zuletzt bearbeitet: 1996-05-26
um 1970 – um 1979
stellt in den 1870er Jahren Stereobilder her
Quelle: William C. Darrah, The World of Stereographs, Gettysburg/Pennsylvania: Selbstverlag, 1977, 127
Schlagwort
Stereo
zuletzt bearbeitet: 1999-01-26
Erwähnung
1869 – 1870
Verfahren aufgrund einer Klage der Schauspielerin Hermine Meyerhoff wegen Ausstellung und Verkauf von zwei Aufnahmen, die sie von im Atelier Adèle von Wilhelm Perlmutter im Mai 1869 hat anfertigen lassen und die Josef Gelen reproduziert hat, Sonnenthal wird verurteilt
Quelle: L. Schrank, “Die Photographie vor Gericht. Zusammenstellung der wichtigsten Entscheidungen in Nachdruckprocessen“, in: Photographische Correspondenz. Organ der photographischen Gesellschaft in Wien. Technische, artistische und commerzielle Mittheilungen aus dem Gebiete der Photographie, unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachmänner redigirt und herausgegeben von Ludwig Schrank, Secretär der photographischen Gesellschaft in Wien und [...], VII. Band, Jänner – December 1870, Nr. 67-78, Wien: Druck- und Commissions-Verlag von Carl Gerold’s Sohn, 1870, 93-109, 115-118), 105-109, 115-118; Alois Nigg, “Oeffentliche Verhandlung über photographischen Nachdruck. Durchgeführt beim Wiener Landgerichte am 5. April 1870“, in: Photographisches Archiv. Berichte über den Fortschritt der Photographie, Hrsg. von Dr. Paul E. Liesegang [...], Bd. 11, Nr. 193-215/216, 1870, Berlin: Theobald Grieben; zweiwöchentlich, 153-156
Schlagwort
Fotorecht, Porträt
zuletzt bearbeitet: 2006-02-20
1970
L. Schrank, “Process der Schauspielerin Hermine Meyerhoff gegen den Photographienhändler Samuel Sonnenthal in Wien“, in: Photographische Zeitung. Central-Organ für die Gesammtinteressen der Photographie. Organ des deutschen Photographentages, Hrsg. und verantwortlicher Redacteur Julius Krüger, 3. Jg., 1870, Berlin: Selbstverlag des Herausgebers; meist wöchentlich, 76-77, 100-101, nachdem Sonnenthal Wiedergaben von Aufnahmen von Wilhelm Perlmutter aus dem Atelier Adele in den Handel gebracht hat
Schlagwort
Fotorecht, Porträt, Prominenz
zuletzt bearbeitet: 2010-07-27
Veröffentlichungen Text
Anzeige
1870
“S. Sonnenthal’s Erstes österreichisches Atelier und Lager für Photografien auf Porzellan, Glas & Email, unverwüstlich eingebrannt, Wien, Michaelerplatz 2, vis a vis dem k.k. Hofburg Theater, Grösstes Lager aller Sorten Photografien des Inn & Auslandes, en gros & en detail“,
Untersatzkarton a.R., um 1870
Schlagwort
Fotokeramik, Fotohandel, Atelierfotograf, Diapositiv?
Standort: Wien: Starl
zuletzt bearbeitet: 1999-01-02
zuletzt bearbeitet: 1996-02-15
http://www.deutschefotothek.de/documents/kue/87200139
Sonnenthal, S.
Künstler-Datensatz 87200139
Tätig 1846/1855 in Wien
Fotograf, Kunsthändler
Nachweisland: Österreich
Weitere Informationen:
Zusatzinformation: Wien, Michaelerplatz 4
Urheber Metadaten: Deutsche Fotothek (Delang, Kerstin)
Permalink:
http://www.deutschefotothek.de/documents/kue/87200139
http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_s/Sonnenthal_Samuel_1840_1896.xml
Sonnenthal, Samuel (1840-[nach] 1896), Photograph und Photoverleger
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 12 (Lfg. 58, 2005), S. 424f.
[ Druckausgabe (PDF) ]
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Straßennamen_von_Wien/Innere_Stadt
Graben,
1294 erstmals als Verkehrsfläche und um 1300 als Marktplatz erwähnt.
Der Graben geht schon auf das alte Römerlager Vindobona zurück, wo eine Mauer entlang des heutigen Straßenzugs und der heutigen Naglergasse die südwestliche Umwallung des Kastells bildete, vor der sich ein Graben befand.
Auch vor der mittelalterlichen Burgmauer war dieser Graben noch vorhanden.
Am Ende des 12. Jahrhunderts wurde der Graben im Zuge der babenbergischen Stadterweiterung zugeschüttet und planiert.
Heute ist der Graben eine der bekanntesten Straßen Wiens.
1971 bzw. 1974 wurde hier die erste Fußgängerzone Wiens eingerichtet.
Teile des Grabens trugen zeitweise verschiedene Bezeichnungen:
Unter den Melbern,
Mehlzeile,
Milchgraben,
Kaltenmarkt,
Fleischgraben,
Grüner Markt und
Kräutermarkt.
Der Graben war einst an beiden Enden kürzer als heute; dem Verkehr im Weg stehende Häuserblöcke wurden 1840 bis nach 1866 demoliert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Graben_(Wien)
Der Graben
ist eine der bekanntesten Straßen im Zentrum der Wiener Altstadt, des 1. Bezirks.
Er geht vom Stock-im-Eisen-Platz / Stephansplatz (mit dem Stephansdom) beim Beginn der Kärntner Straße aus und führt Richtung Nordwesten zur Querachse Kohlmarkt–Tuchlauben.
Vom Graben, der als Fußgängerbereich platzartig gestaltet wurde, zweigen schmale historische Gassen ab.
Er fungiert als luxuriöse Einkaufs- und Flanierstraße und bildet mit Kärntner Straße und Kohlmarkt das „goldene U“ des Wiener Handels.
Pestsäule
![Wiener Pestsaeule]()
Anlässlich der Beendigung einer Pestepidemie im Jahr 1679 gelobte Kaiser Leopold I. die Errichtung einer Gnadensäule zu Ehren der heiligen Dreifaltigkeit. Noch im selben Jahr wurde mit der Errichtung begonnen, es kam jedoch zu zahlreichen Änderungen in der Planung und zum Wechsel der beteiligten Künstler. Erst 1692 wurde die Säule unter der Leitung von Paul Strudel vollendet.
Die fast 19 m hohe Säule weist ein komplexes ikonographisches Programm auf, in dem die Dreizahl eine besondere Rolle spielt. Es dient nicht nur der Verherrlichung der Dreifaltigkeit sondern auch den politischen Zielen Leopolds.
Die Wiener Pestsäule war stilprägend und wurde in der ganzen Monarchie nachgeahmt.
Grabenbrunnen
![Wien Graben Josefsbrunnen]()
Auf dem Graben befinden sich zwei Brunnen. In den städtischen Rechnungsbüchern waren schon 1455 Ausgaben für einen Brunnen zu finden, dessen Wasser in Röhren vom Garten der Hofburg hergeleitet wurde, das steinerne Brunnenhaus war von der Bildsäule des Hl. Florian bekrönt. Die Florianstatue gibt einen Hinweis auf den Zweck des Brunnens, er diente in erster Linie zum Löschen auftretender Feuersbrünste. Den vom Steinmetzmeister Hanns (Puchsbaum) geschaffenen Brunnen zierten vier Löwenköpfe, deshalb bezeichnete man ihn bald als Löwenbrunnen.
Er stand an der Westseite des Grabens vor dem Haus “Zum goldenen Hirschen”.
Neben Meister Hanns wurde noch Meister Augustin Ratsmid namentlich genannt, er schuf die Löwenköpfe.
Als man 1638 beschloss, eine neue Feuerordnung einzuführen, befand es die niederösterreichische Regierung für notwendig, neue Röhrenbrunnen auf der Freyung und dem Graben zu errichten. Es erging ein Steinmetzauftrag an Meister Hieronymus Bregno mit seinem Gesellen Francesco della Torre, aus dem kaiserlichen Steinbruch am Leithaberg, welcher für seine Arbeiten vermutlich Kaiserstein verwendete. Für diesen Brunnen gestaltete der Bildhauer Johann Jacob Pock ein Jupiter-Standbild.
Auf dem Gegenstück beim Haus „Zum schwarzen Elefanten“ befand sich keine Figur, man kann den Aufbau am ehesten mit einer gotischen Fiale vergleichen. Der (südöstliche) Brunnen stammt vermutlich von 1561.
Auf Wunsch von Kaiser Leopold I. wurden die Brunnen 1680 mit Standbildern der Heiligen Joseph und Leopold versehen, die vom Bildhauer Johann Frühwirth angefertigt wurden.
Diese wurden 1804 durch Bleifiguren von Johann Martin Fischer ersetzt. Die Statuen von Frühwirth sind seither verschollen. Beide gegenwärtigen Brunnen sind aus Wöllersdorfer Stein gehauen.
Sie sind unter den Namen Josefsbrunnen und Leopoldsbrunnen bekannt.
Unterhalb des Josefsbrunnens befindet sich Wiens älteste unterirdische Bedürfnisanstalt, die Öffentliche Bedürfnisanstalt am Graben.
Mag. Ingrid Moschik,
Konzeptkünstlerin
Ideen und Informationen bitte an:
ingrid.moschik@yahoo.de
![]()
![]()